Verwandte Themen
Während im deutschsprachigen Raum erfolgreiche Regionalprojekte wie Crossair, Tyrolean, DLT oder Eurowings inzwischen allesamt bei den nationalen Flagcarriern gelandet sind, gerieten eigenständige Konzernpartner wie Contact Air, Augsburg Airways, Cirrus Airlines oder Air Alps in eine letale Abhängigkeit und damit letztlich ins Aus. Übrig blieben ein paar Miniairlines wie Darwin, Intersky oder Skyworks, die eine ungewisse Zukunft eint.
Triebkraft hinter dieser "Auslese" ist die Interessensallianz der Hubcarrier mit ihren Heimat-Airports, die Fläche möglichst zentral an sich zu binden.
Die Ökonomie des Regionalbetriebs basiert auf einem Kompromiss zwischen Bedarf und Angebot. Der Trend zu Hundertsitzern folgt einerseits dem wachsenden Kostendruck, anderseits wird dadurch die Entwicklung neuer, wie auch die Bedienung kleiner Regionalmärkte gravierend eingeschränkt.
Umsteigen auf der Kurzstrecke kostet - nicht nur wegen dem hohen Verbrauch kapitalintensiver Ressourcen, sondern auch wegen der in der dünn besiedelten Fläche nur schwer absetzbaren Basiskapazitäten. Eben darin liegt jedoch die Stärke der Privaten. Kleingerät muss kein Nachteil sein, wenn die Bedingungen stimmen.
Haben die Gesetzgeber, in Anbetracht der immensen Investitionen in den beschleunigten Landverkehr, überhaupt noch ein Interesse am regionalen Flugverkehr?
Während es für Regionalflughäfen EU-weit noch bis 2022 mit Steuergeld finanzierte Subventionen gibt, bleiben die privaten Verkehrsträger weitgehend auf sich selbst gestellt. Weder stehen ihnen Förderungen noch ein regulierter Schutz zur Entwicklung neuer Märkte zu. Einzig die Anbindung periphärer Regionen wird noch gefördert.
Die absehbare Folge: mit kalkulierten Verlusten drängen kapitalstarke Konzernableger mittelständische Mitbewerber oft schon im Vorfeld aus dem Markt.
Die Regionalflieger müssen sich neu erfinden
Alle erfolgreichen Regionalairlines starteten mit einer überschaubaren Kapitalausstattung und bedarfsgerechtem Fluggerät mit weniger als 50 Sitzen. Dank niedriger Overheads gelang ihnen damit die Erschließung völlig neuer Marktsegmente, Carriern wie Crossair oder Tyrolean auch über eigene Regionalhubs wie Basel oder Salzburg.
Die aus der Nürnberger NFD und der Dortmunder RFG hervorgegangene Eurowings baute indessen ein beachtliches Zubringernetz zu den Hubs der Air France-KLM Gruppe auf.
Weniger erfolgreich war die regionale Versorgung durch die Flagcarrier. Mit der Übernahme der Regionalen sollte sich das ändern, was sich geändert hat, war letztlich aber nur ein kräftig reduziertes Angebot, vor allem im regionalen Direktverkehr.
LOT Polish Airlines ging mit der Gründung einer eigenständigen Regionaltochter den umgekehrten Weg. Ebenso ohne Erfolg. Mit der Liquidation der EuroLOT scheiterte jetzt auch ein staatliches Hybridprojekt mit privatem Venturekapital. Ab April 2015 obliegt das Regionalgeschäft wieder der (staatlichen) Mutter - vernehmlich ebenfalls mit reduziertem Angebot.
Zeit zum Handeln
Der Regionalverkehr hat nach wie vor Potential, sowohl im Inland als auch im grenzüberschreitenden Verkehr: Trotz wachsender Konkurrenz auf der Schiene werden adequate Flugverbindungen auch in der Fläche verlangt, nicht nur von der lokalen Wirtschaft.
Um die Anbieter aber auf Strecke zu halten, sind europaweit entwicklungsfreundlichere Rahmenbedingungen von Nöten, denn ohne marktgerechte Angebote werden auch hochsubventionierte Flughäfen auf der Strecke bleiben, und damit die Kunden.





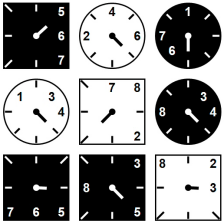

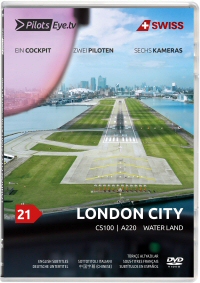
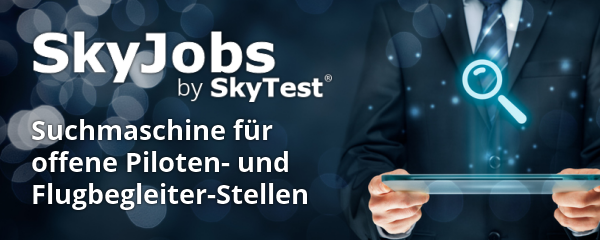
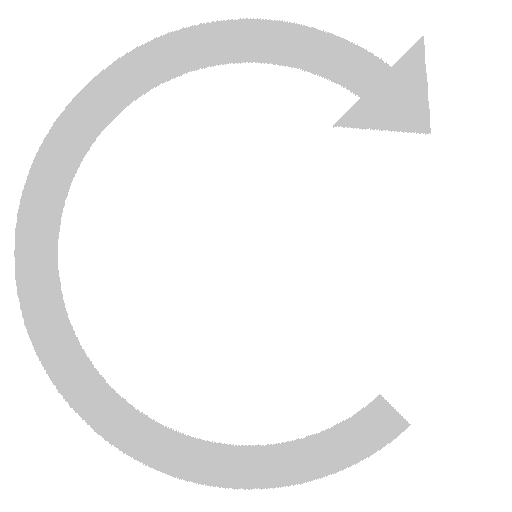

Kommentare (0) Zur Startseite
Um einen Kommentar schreiben zu können, müssen Sie sich bei aero.de registrieren oder einloggen.