Ihren Jungfernflug hatte die Rakete im vergangenen Sommer weitgehend erfolgreich absolviert. Europa kann mit der Ariane 6 eigenständig größere Satelliten in den Weltraum bringen.
Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis 2023 im Einsatz war. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist laut der europäischen Raumfahrtagentur Esa deutlich günstiger als ihre Vorgängerin.
Je nach Mission kann die flexible und modulare Rakete mit zwei oder vier Boostern ausgestattet werden. Beim Erstflug im Juli und nun auch flog sie mit zweien, Ende des Jahres soll sie erstmals mit vier Boostern abheben.
Die Rakete kann bis zu 11,5 Tonnen Nutzlast in höhere und bis zu 21,6 Tonnen in niedrigere Umlaufbahnen transportieren. Durch die Möglichkeit, die Oberstufe wiederholt zu zünden, kann die Ariane 6 Satelliten in verschiedene Positionen und Umlaufbahnen platzieren.
Die Esa sieht die Rakete als den aktuellen Herausforderungen gewachsen an. Der Raumfahrtexperte Martin Tajmar von der TU Dresden meint hingegen, dass sie nicht auf der Höhe der Zeit sei - zum Beispiel, weil sie nicht wiederverwendbar ist.
Zeitweise Krise mit Erststart überwunden
Eigentlich hätte die Ariane 6 bereits 2020 ins All fliegen sollen. Immer wieder kam es zu Verzögerungen. Die Rakete hob letztlich mit vier Jahren Verspätung erstmals ab. Ihre Vorgängerin war zu dem Zeitpunkt schon seit etwa einem Jahr nicht mehr im Dienst und die Vega C, die kleinere Satelliten transportiert, blieb nach ihrem gescheiterten kommerziellen Erststart am Boden.
Die Esa sprach von einer Krise des Trägerraketensektors. Teils wich sie auf Falcon-9-Raketen des US-Unternehmens SpaceX aus. Mit dem Ariane-6-Erststart sah die Esa die Krise als überwunden an.
Auch Deutschland hat Beitrag geleistet
Am Bau der Ariane 6 waren gut ein Dutzend Länder beteiligt. Die Oberstufe wurde in Bremen montiert, die Tanks der Oberstufe und Teile des Triebwerks kommen aus Augsburg beziehungsweise Ottobrunn. Im baden-württembergischen Lampoldshausen wurde das Vinci-Triebwerk getestet. Nach Frankreich ist Deutschland unter den Esa-Ländern der wichtigste Geldgeber und hat etwa 20 Prozent der Kosten von rund vier Milliarden Euro geschultert.
© dpa-AFX | Abb.: Ariane Space | 06.03.2025 17:34




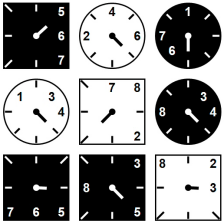


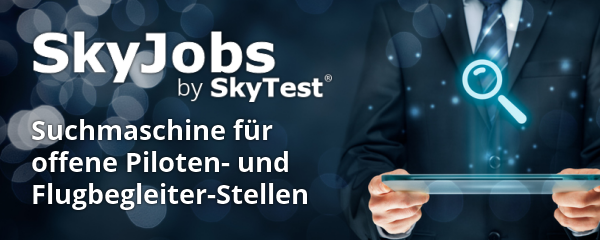
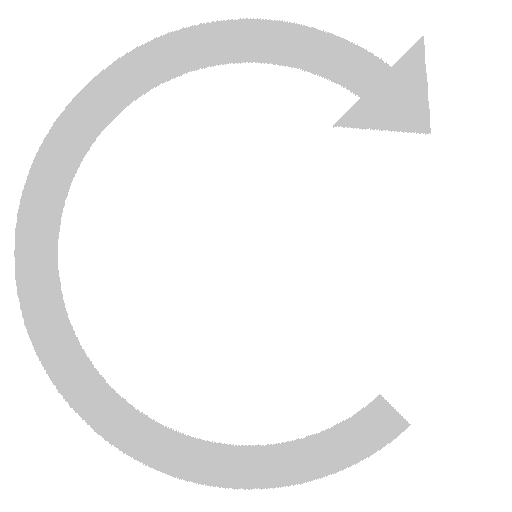

Kommentare (1) Zur Startseite
Um einen Kommentar schreiben zu können, müssen Sie sich bei aero.de registrieren oder einloggen.
"Nicht auf der Höhe der Zeit" ist mMn eine Bewertung auf dieser rein kommerziellen Basis, speziell der Wiederverwendbarkeit der Falcon Unterstufe.
SpaceX will mit der Wiederverwendbarkeit einen Massenmarkt bedienen. Dafür nehmen sie große Kompromisse bei erzielbarer Nutzlast und Zielorbits in Kauf.
Ariane 6 (Konfiguration 64):
Kapazität LEO: 21,6 t
Kapazität GTO: 12.0 t
Falcon 9:
Kapazität LEO
- expended: 22,8 t
- wiederverwendbar: 17,5 t
Kapazität GTO
- expended: 8,3 t
- wiederverwendbar: 5,5 t
Die Falcon 9 ist jenseits von Skalierungseffekten daher nur dann wirklich billiger, wenn man deutlich unter der Nutzlast der Ariane 6 bleibt und damit die Erststufe im wiederverwendbaren Modus betreiben kann.
Die Oberstufe der Falcon 9 geht ja auch in allen Fällen verloren.
Zudem erscheint es gerade aktuell wichtig zu sein, über einen eigenständigen Zugang zum LEO zu verfügen. Den weder ein US Präsident auf dem Kriegspfad noch ein unter Drogen stehender Milliardär kappen kann.